Ohne Vermerk auf der Gästeliste kommt man in Berlin bald bei keiner Party und keinem Konzert mehr rein. Und so verbringt man Samstagabende hauptsächlich mit Warten, Hoffen und Herumstehen in der Kälte. Das muss aufhören!
Dieser Artikel ist zuerst erscheinen am 21.10.2017 auf iconist.de.
Wo sich folgende Geschichte genau abgespielt hat, kann ich nicht verraten. Sonst ruiniere ich mir höchstwahrscheinlich sämtliche Chancen, jemals noch ein Ticket für eine Veranstaltung der Konzertreihe zu bekommen. Na gut, ein paar unverfängliche Angaben: Samstagabend, Kreuzberg, ein junger, ziemlich berühmter Pianist sollte spielen, Tickets nur sieben Euro, voll demokratisch eben. Gute Musik für alle, auch die, die sich kein Philharmoniker-Abo leisten können.
Zwei Stunden vor Beginn des Konzerts stand ich in der Kälte in einem Kreuzberger Hinterhof. Zusammen mit ungefähr 200 anderen Menschen. Es ging nicht wirklich vorwärts, ich dachte mir erst mal nichts dabei. Bis eine Frau erschien, die aussah, wie alle aussehen, die in Berlin auf der organisatorischen Seite von Kulturveranstaltungen arbeiten: brauner Pony und Brille in 70er-Jahre-Tropfenform.
Ich mochte sie gleich nicht, und das, was sie uns Wartenden mitzuteilen hatte, noch viel weniger: Leider, leider könne man nicht garantieren, dass noch überhaupt jemand eine Karte fürs Konzert bekäme. Die Gästeliste sei sehr umfangreich, der Künstler habe nun mal viele Freunde eingeladen, und die Location sei klein. Man müsse abwarten, wie viele Leute von der Gästeliste wirklich erschienen, erst dann bestehe eventuell, vielleicht noch die Möglichkeit, dass noch andere reinkämen.
Andere, normale Menschen, die sich noch ohne Gästelistenplätze ins Berliner Nachtleben wagen. Schön blöd. Werde ich garantiert nicht mehr machen.
Ohne Connections zu Pressefrauen, Partyveranstaltern und Künstlern verbringt man einen Samstagabend in Berlin nämlich hauptsächlich mit Rumstehen, Warten und Hoffen. Unbeschwert losziehen und feiern, das ist in dieser Stadt einfach nicht drin. Egal, ob es um ein Konzert, eine Party oder eine verdammte Popupshoperöffnung geht – überall stehen mehr Menschen auf der Gästeliste, als in den Club, den Shop, den Konzertsaal überhaupt reinpassen.
Das ist nicht nur superunwirtschaftlich. Ich muss sagen, ich finde, man kann so einen Samstagabend auch netter verbringen, als sich stundenlang mit irgendwelchen Strategien zu beschäftigen, wie man es am Gästelisten-Counter vorbeischaffen könnte: „Warte mal, die eine Musikproduzentin, die wir vor fünf Jahren mal kurz bei einem Empfang getroffen haben, vielleicht können wir die ansprechen? Oder ist das zu dreist? Ja, komm, ist zu dreist. Wobei. Hallo, Anna, erinnerst Du Dich an uns???? Wir haben uns mal kennengelernt, bei, ach, genau…. Äh, kurze Frage, hast Du Liste?“
Das ist doch schrecklich. Das muss aufhören! Ich habe wirklich keine Lust mehr, mich unter falschen Namen auf Veranstaltungen zu schmuggeln, mich der Türpolitik bestimmter Clubs zu beugen und mich ganz anders anzuziehen, als ich das normalerweise tun würde, vor jeder Party krampfhaft meinen Facebook-Account nach Leuten zu durchsuchen, die jemanden kennen könnten, der jemanden kennt und so weiter.
Mit 16 musste ich für jede Turnhallen-Dorfparty einen Erlaubniszettel von meinen Eltern erbetteln, damit ich länger als bis null Uhr bleiben durfte. Die Verhandlungen darüber kommen mir im Nachhinein vergleichsweise entspannt vor. Zumindest angenehmer als die Gespräche mit glatzköpfigen Türstehern, die sich „Selekteure“ nennen, weil sie glauben, dass sich das vornehm anhört. Anderweitige Assoziationen zu diesem Begriff muss sich jeder selbst überlegen.
Momentan sehe ich nur noch eine Möglichkeit, diesem Gästelisten-Terror künftig zu entgehen und mal wieder einen Abend zu erleben, an dem ich mich nicht völlig genervt, müde und erkältet um halb zwei ins Taxi setze und nach Hause fahre. Ich muss möglichst schnell berühmt und wichtig werden. Oder selbst in die Türsteher- und Gästelistenverwalterbranche wechseln. Beides ist leider unwahrscheinlich.
Um die Geschichte aus Kreuzberg zu Ende zu erzählen: Beim Konzert kam natürlich niemand mehr rein, der nicht auf der Gästeliste stand. Die Pony-und-Brille-Frau kam sich ganz schrecklich wichtig vor und wiederholte ihr Sätzchen von den vielen Freunden des Pianisten und der kleinen Location noch ungefähr 500 Mal. Und das auch noch in einem mitleidigen Sonderpädagogen-Tonfall. Dabei war klar, dass es ihr überhaupt nicht leid tat, dass der Abend für sehr viele Menschen ruiniert war. Sie freute sich, auf der anderen Seite zu stehen. Und über ihre Macht in Form einer Exceltabelle.
Als ich schließlich aufgab und ging – ich hatte nicht einmal mehr die Kraft, irgendwas mit meinen Presseausweis zu versuchen, aber gut, in Berlin ist sowieso jeder irgendwie Journalist –, jedenfalls traf ich beim Gehen noch eine alte Bekannte. Sie arbeite jetzt bei einer großen Musikfirma – ich solle ihr das nächste Mal Bescheid geben, sie kriege immer Karten für die Konzertreihe. Ich war geistesgegenwärtig genug, ihre Handynummer abzuspeichern. Vielleicht wendet sich das Gästelisten-Schicksal für mich ja doch noch mal.

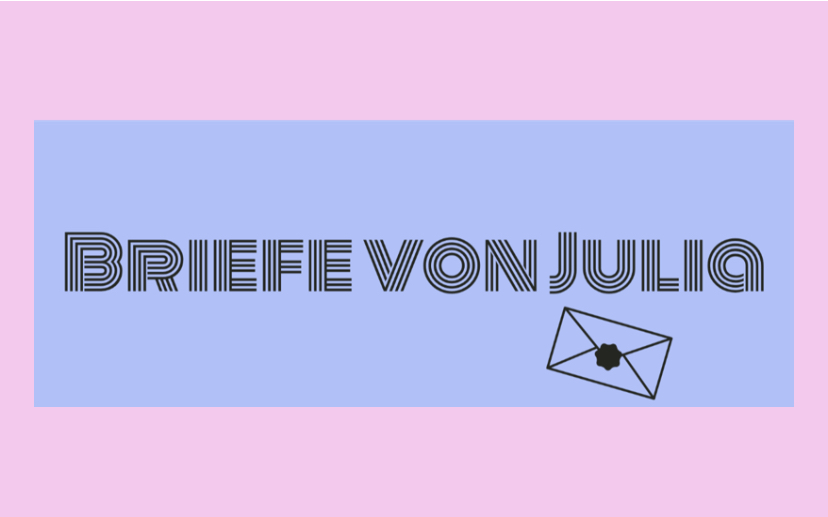


Schreibe einen Kommentar